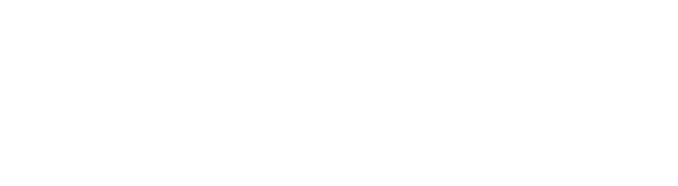Pflanzlicher Fisch und Meeresfrüchte sind mehr als ein Ernährungstrend. Aber sie fordern unser Verständnis von Genuss, Nachhaltigkeit und Innovation heraus. Mitgründer Severin Eder will diesen Raum mit catchfree nicht einfach besetzen, sondern neu definieren – mit Technologie, Teamarbeit und einer Portion kulinarischer Erfahrung.
Was war der Moment, in dem ihr wusstet, dass ihr catchfree gründen wollt?
Die Idee entstand aus unseren unterschiedlichen Perspektiven auf das Lebensmittelsystem. Eduard Müller brachte seine Erfahrungen aus der Gastronomie und vom Studium an der HSG ein, ich kam mit einem wissenschaftlichen Blick von der ETH. Uns war schnell klar, dass die Art, wie Fisch heute produziert und konsumiert wird, dringend neue Ansätze braucht. Überfischung, problematische Aquakulturen und ein wachsender Bedarf an nachhaltigen Alternativen führten schliesslich zur Gründung von catchfree im August 2024.
Wie hat dich dein akademischer Hintergrund auf das Gründen vorbereitet?
Mein PhD in Food Science an der ETH hat mir beigebracht, mit Unsicherheit umzugehen. In der Forschung scheitert man oft, muss ständig neu denken und dranbleiben. Diese Art zu arbeiten hilft mir heute im Alltag eines Startups, wo man selten den perfekten Plan hat und immer wieder Kurskorrekturen nötig sind.
Was war schwieriger, als du es erwartet hattest?
Ich hatte unterschätzt, wie sehr man als Gründer von Faktoren abhängig ist, die man selbst nicht kontrollieren kann. Man ist auf Lieferketten, regulatorische Rahmenbedingungen, Förderstrukturen oder auch das Timing des Marktes angewiesen. Gleichzeitig zwingt genau das dazu, agil zu bleiben. Man kann nicht alles durchplanen, sondern muss laufend Entscheidungen treffen mit begrenztem Wissen. Diese Ungewissheit auszuhalten und trotzdem fokussiert zu bleiben, ist etwas, das man erst lernt, wenn man mittendrin steckt.
Wie hat sich dein Bild vom Unternehmertum seit der Gründung verändert?
Früher dachte ich, Unternehmertum bedeute in erster Linie, ein Problem mit Technologie zu lösen. Inzwischen sehe ich es breiter. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen für einen Prozess, der über die Produktentwicklung hinausgeht. Man ist ständig damit beschäftigt, zwischen Menschen zu vermitteln, Ziele zu schärfen, Bedürfnisse zu verstehen und gleichzeitig ein Unternehmen am Laufen zu halten. Es ist weniger heroisch, als es oft erzählt wird, aber dafür auch deutlich menschlicher.
Gab es Momente, in denen ihr fast aufgegeben hättet?
Ja, definitiv. Es gab Phasen, in denen wir das Gefühl hatten, dass nichts vorwärtsgeht, obwohl wir alles geben. Besonders am Anfang, als wir mit den ersten Prototypen scheiterten oder Förderanträge abgelehnt wurden. Da kamen Zweifel auf. Aber wir hatten das Glück, ein stabiles Team zu sein. Eddy und ich haben ein gemeinsames Verständnis davon, warum wir das machen. Und dieses gemeinsame Warum hat uns geholfen, dranzubleiben, auch wenn es schwierig wurde.
Was habt ihr beim Aufbau von catchfree rückblickend zu spät erkannt?
Wir hätten früher direktes Feedback einholen sollen, auch von Zielgruppen, die mit pflanzlichen Produkten wenig Erfahrung haben. Am Anfang waren wir zu vorsichtig, was das Teilen unserer ersten Prototypen anging. Heute wissen wir, wie wertvoll es ist, früh Rückmeldungen einzuholen, auch wenn das Produkt noch nicht perfekt ist.
Wie läuft bei euch die Produktentwicklung ab?
Wir bringen verschiedene Perspektiven zusammen. Eddy hat nicht nur ein betriebswirtschaftliches Profil, sondern auch praktische Erfahrung aus der Spitzengastronomie. Ich komme aus der Forschung. Gemeinsam testen wir unsere Produkte mit Köchen und holen uns direktes Feedback. So entsteht etwas, das nicht nur technisch funktioniert, sondern auch schmeckt.

Bild: Täuschend echt: Pflanzliche Crevetten von catchfree serviert als Tacos.
Wie reagieren klassische Anbieter auf euch?
In der Schweiz stammen über 90 Prozent aller Fisch- und Meeresfrüchteprodukte aus dem Ausland. Das öffnet Türen, auch für Kooperationen. Wir wollen nicht gegen bestehende Strukturen arbeiten, sondern neue Partnerschaften ermöglichen. catchfree soll Teil einer neuen, nachhaltigen Wertschöpfungskette werden.
Was war das überraschendste Feedback zu euren Produkten?
Bei einem Dinner während der Food Zurich waren unsere Crevetten Teil eines Menüs. Einige Gäste dachten, sie könnten es wegen einer Meeresfrüchteallergie nicht essen. Dass unsere pflanzliche Alternative so täuschend echt wirkt, war ein starkes Zeichen. Für uns war das eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Was hast du persönlich über Lebensmittel gelernt, seit du catchfree gegründet hast?
Mir wurde klar, wie emotional Essen ist. Es geht nicht nur um Geschmack oder Inhaltsstoffe, sondern um Kultur, Identität und Gewohnheit. Neue Produkte lösen Reaktionen aus, manchmal Zustimmung, manchmal Skepsis. Als Gründer muss man lernen, mit beidem umzugehen. Und Wege finden, Brücken zu bauen statt Fronten.
Dir hat das Interview gefallen?
Dann wirf doch auch einen Blick auf unser letztes Interview – viel Spass beim lesen!
FOUNDED
Videoformat
“23 Questions mit…”
In unserem neuen Format stellen wir Gründerinnen, Gründern oder Teammitgliedern 23 Fragen in einem One-Take – während wir durch die Firma gehen. Kein Skript, kein Cut, kein Studio. Nur echtes Startup-Leben.
23 Questions mit Scewo.
Pflanzlicher Fisch und Meeresfrüchte sind mehr als ein Ernährungstrend. Aber sie fordern unser Verständnis von Genuss, Nachhaltigkeit und Innovation heraus. Mitgründer Severin Eder will diesen Raum mit catchfree nicht einfach besetzen, sondern neu definieren – mit Technologie, Teamarbeit und einer Portion kulinarischer Erfahrung.
Was war der Moment, in dem ihr wusstet, dass ihr catchfree gründen wollt?
Die Idee entstand aus unseren unterschiedlichen Perspektiven auf das Lebensmittelsystem. Eduard Müller brachte seine Erfahrungen aus der Gastronomie und vom Studium an der HSG ein, ich kam mit einem wissenschaftlichen Blick von der ETH. Uns war schnell klar, dass die Art, wie Fisch heute produziert und konsumiert wird, dringend neue Ansätze braucht. Überfischung, problematische Aquakulturen und ein wachsender Bedarf an nachhaltigen Alternativen führten schliesslich zur Gründung von catchfree im August 2024.
Wie hat dich dein akademischer Hintergrund auf das Gründen vorbereitet?
Mein PhD in Food Science an der ETH hat mir beigebracht, mit Unsicherheit umzugehen. In der Forschung scheitert man oft, muss ständig neu denken und dranbleiben. Diese Art zu arbeiten hilft mir heute im Alltag eines Startups, wo man selten den perfekten Plan hat und immer wieder Kurskorrekturen nötig sind.
Was war schwieriger, als du es erwartet hattest?
Ich hatte unterschätzt, wie sehr man als Gründer von Faktoren abhängig ist, die man selbst nicht kontrollieren kann. Man ist auf Lieferketten, regulatorische Rahmenbedingungen, Förderstrukturen oder auch das Timing des Marktes angewiesen. Gleichzeitig zwingt genau das dazu, agil zu bleiben. Man kann nicht alles durchplanen, sondern muss laufend Entscheidungen treffen mit begrenztem Wissen. Diese Ungewissheit auszuhalten und trotzdem fokussiert zu bleiben, ist etwas, das man erst lernt, wenn man mittendrin steckt.
Wie hat sich dein Bild vom Unternehmertum seit der Gründung verändert?
Früher dachte ich, Unternehmertum bedeute in erster Linie, ein Problem mit Technologie zu lösen. Inzwischen sehe ich es breiter. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen für einen Prozess, der über die Produktentwicklung hinausgeht. Man ist ständig damit beschäftigt, zwischen Menschen zu vermitteln, Ziele zu schärfen, Bedürfnisse zu verstehen und gleichzeitig ein Unternehmen am Laufen zu halten. Es ist weniger heroisch, als es oft erzählt wird, aber dafür auch deutlich menschlicher.
Gab es Momente, in denen ihr fast aufgegeben hättet?
Ja, definitiv. Es gab Phasen, in denen wir das Gefühl hatten, dass nichts vorwärtsgeht, obwohl wir alles geben. Besonders am Anfang, als wir mit den ersten Prototypen scheiterten oder Förderanträge abgelehnt wurden. Da kamen Zweifel auf. Aber wir hatten das Glück, ein stabiles Team zu sein. Eddy und ich haben ein gemeinsames Verständnis davon, warum wir das machen. Und dieses gemeinsame Warum hat uns geholfen, dranzubleiben, auch wenn es schwierig wurde.
Was habt ihr beim Aufbau von catchfree rückblickend zu spät erkannt?
Wir hätten früher direktes Feedback einholen sollen, auch von Zielgruppen, die mit pflanzlichen Produkten wenig Erfahrung haben. Am Anfang waren wir zu vorsichtig, was das Teilen unserer ersten Prototypen anging. Heute wissen wir, wie wertvoll es ist, früh Rückmeldungen einzuholen, auch wenn das Produkt noch nicht perfekt ist.
Wie läuft bei euch die Produktentwicklung ab?
Wir bringen verschiedene Perspektiven zusammen. Eddy hat nicht nur ein betriebswirtschaftliches Profil, sondern auch praktische Erfahrung aus der Spitzengastronomie. Ich komme aus der Forschung. Gemeinsam testen wir unsere Produkte mit Köchen und holen uns direktes Feedback. So entsteht etwas, das nicht nur technisch funktioniert, sondern auch schmeckt.

Bild: Täuschend echt: Pflanzliche Crevetten von catchfree serviert als Tacos.
Wie reagieren klassische Anbieter auf euch?
In der Schweiz stammen über 90 Prozent aller Fisch- und Meeresfrüchteprodukte aus dem Ausland. Das öffnet Türen, auch für Kooperationen. Wir wollen nicht gegen bestehende Strukturen arbeiten, sondern neue Partnerschaften ermöglichen. catchfree soll Teil einer neuen, nachhaltigen Wertschöpfungskette werden.
Was war das überraschendste Feedback zu euren Produkten?
Bei einem Dinner während der Food Zurich waren unsere Crevetten Teil eines Menüs. Einige Gäste dachten, sie könnten es wegen einer Meeresfrüchteallergie nicht essen. Dass unsere pflanzliche Alternative so täuschend echt wirkt, war ein starkes Zeichen. Für uns war das eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Was hast du persönlich über Lebensmittel gelernt, seit du catchfree gegründet hast?
Mir wurde klar, wie emotional Essen ist. Es geht nicht nur um Geschmack oder Inhaltsstoffe, sondern um Kultur, Identität und Gewohnheit. Neue Produkte lösen Reaktionen aus, manchmal Zustimmung, manchmal Skepsis. Als Gründer muss man lernen, mit beidem umzugehen. Und Wege finden, Brücken zu bauen statt Fronten.
Dir hat das Interview gefallen?
Dann wirf doch auch einen Blick auf unser letztes Interview – viel Spass beim lesen!