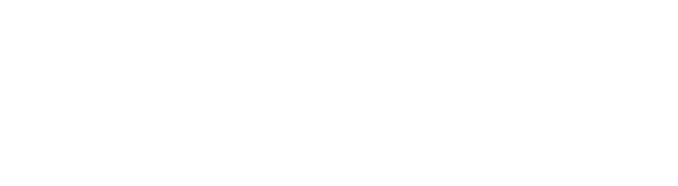Samantha Anderson war Chemikerin, als sie sich entschied, nicht nur zu forschen, sondern eine Lösung zu bauen. Mit DePoly zerlegt sie nicht nur PET-Flaschen, sondern auch gängige Vorstellungen von Recycling.
Wie würdest du DePoly einem zwölfjährigen Kind erklären, das gerade zum ersten Mal von Recycling und zirkulärer Wirtschaft hört?
Stell dir vor, du machst für deine beste Freundin ein Armband, das aus bunten Perlen besteht. Wenn du dich später umentscheiden und aus genau diesen Perlen eine Kette basteln willst, musst du das Armband wieder auseinandernehmen, oder? Genau das macht DePoly mit Plastik. Unsere Technologie nimmt altes Plastik, das sonst verbrannt oder weggeworfen würde, und zerlegt es wieder in seine Einzelteile, um dann später wieder ein neues Produkt aus den Einzelteilen entstehen zu lassen – ganz wie bei dem Armband.
Wir glauben daran, dass Recycling nicht kompliziert sein muss, sondern nur die richtige Handhabe braucht. Unsere Technologie zerlegt Plastik nicht nur, sie funktioniert auch mit Plastik, das normalerweise gar nicht recycelbar wäre, wie bunt gemischter Verpackungsmüll oder alte Textilien. Wir geben Kunststoffabfällen also ein zweites Leben und helfen damit, die Umwelt zu entlasten.
Wann wurde euch klar, dass aus eurem Forschungsprojekt ein Unternehmen werden sollte?
2018 war plötzlich überall von Mikroplastik die Rede, in den Medien, in der Politik, in der Forschung. Immer mehr Studien zeigten, dass sich Mikroplastik in unserem Körper nachweisen lässt. Doch aus wissenschaftlicher Sicht gab es damals noch keine Antworten auf die Frage: Was macht dieses Plastik eigentlich mit uns? Das war natürlich fatal und hat mich entsprechend angetrieben, eine Lösung für dieses riesige Problem zu finden.
Gemeinsam mit meinen Mitgründern Christopher und Bardiya habe ich dann beschlossen, genau dort anzusetzen, und zwar mit Hilfe meines Backgrounds als Chemikerin. Mit einem chemischen Ansatz wollten wir Plastik in seine Einzelteile zurückführen. Das Forschungsprojekt sollte von Anfang an nicht akademisch bleiben. Wir wollten eine skalierbare Technologie schaffen, und das ging am schnellsten mit einem Startup.
Wie verändert sich die Rolle als CEO, wenn aus Laborlogik plötzlich industrielle Skalierung wird?
Am Anfang hat sich meine Rolle als CEO gar nicht so sehr von der wissenschaftlichen Arbeit unterschieden, sodass es sich noch sehr vertraut angefühlt hat. Wir waren ein kleines Team, weniger als zehn Personen, und haben gemeinsam überlegt, wie wir unsere Technologie weiterentwickeln und in Richtung Kommerzialisierung bringen können. Ich war noch sehr nah an der Forschung dran.
Irgendwann kommt dann der Punkt, an dem man beginnt, Aufgaben abzugeben. Es gibt diesen Artikel von Molly Graham mit dem Titel «Give Away Your Legos», der beschreibt, wie man in einem Startup lernen muss, bestimmte Verantwortlichkeiten loszulassen, um Platz für neue Rollen und Wachstum zu schaffen. Und genau das passiert. Man stellt Leute ein, die Dinge besser können als man selbst, und plötzlich ist man nicht mehr im Labor, sondern hält Präsentationen vor Investorinnen und Investoren, schreibt Businesspläne und beschäftigt sich mit Teamführung, Unternehmensaufbau und Finanzierung.
Heute habe ich mit der eigentlichen Chemie kaum noch etwas zu tun. Natürlich vermisse ich manchmal die wissenschaftliche Arbeit, ich war zehn Jahre lang Chemikerin und liebe die Neugier, das Entdecken. Aber auf der anderen Seite sehe ich jetzt dieses Unternehmen entstehen und wachsen. Es ist ein bisschen so, als würde man ein Kind beim Aufwachsen beobachten, das nimmt mir die Wehmut nach dem Labor.
Wie findet man die richtigen Leute, um ein Forschungsteam zu ergänzen und gleichzeitig ein Start-up aufzubauen?
Wenn es um das wissenschaftliche Team ging, war das anfangs noch relativ einfach, da habe ich mich in einer vertrauten Welt bewegt. Man kennt viele Leute aus der Forschung, weiss, wie sie arbeiten, und kann gut einschätzen, wer ins Team passt. Schwieriger wird es bei den Businessrollen: Wer sich aus der Forschung heraus selbstständig macht, bringt selten Erfahrung im Aufbau eines Unternehmens mit. Uns hat da vor allem unser Netzwerk geholfen, insbesondere unser VC Founderful. Sie haben uns mit Leuten aus ihrem Ökosystem verbunden, das war super hilfreich.
Und wie bringt ihr eure Technologie dann aus dem Labor in die Industrie?
Wir arbeiten eng mit Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen, von der chemischen Industrie über Abfüller bis hin zu Textilherstellern. Besonders stolz sind wir auf das jüngste Projekt mit der Sportmarke Odlo: Gemeinsam entwickeln wir den ersten vollständig zirkulären Base Layer der Marke. Dabei wird gebrauchte Funktionskleidung mit unserer Technologie wieder in hochwertige Rohstoffe zerlegt und daraus ein neues Kleidungsstück geschaffen. Dieses Pilotprojekt ist ein wichtiger Beweis dafür, wie echte Kreislaufwirtschaft in der Realität funktionieren kann. Solche Kooperationen zeigen, dass Recycling nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein industriell relevantes Modell ist.
Ihr arbeitet an einer bekannten Herausforderung. Wie politisch darf oder sollte man als Gründerin sein?
Als Gründerin sehe ich es als selbstverständlich an, für unsere Technologie und unser Anliegen einzustehen, gerade weil wir an einem der grossen systemischen Probleme unserer Zeit arbeiten: unsere Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen und die daraus resultierende Plastikverschmutzung. Ich bin daher offen für Gespräche mit Verbänden oder politischen Entscheidungstragenden, um unser Wissen einzubringen und auf die strukturellen Herausforderungen hinzuweisen. Generell bin ich aber kein besonders politisch aktiver Mensch, zumindest nicht auf Social Media. Unsere Herangehensweise ist eher edukativ.
Wir investieren Zeit in Aufklärungsarbeit, sprechen in Schulen, empfangen Kinder in unseren Laboren und erklären ihnen, wie unsere Technologie funktioniert. Denn echte Veränderung beginnt oft mit Verständnis.
Wie erlebst du das Gründen als Frau, gerade in der Tech-Welt?
Ich persönlich habe bisher positive Erfahrungen gemacht. Die Schweizer Gründungscommunity ist respektvoll, offen und unterstützt Frauen, zumindest so, wie ich es erlebt habe. Ich fühle mich in diesem Umfeld sehr wohl und hatte nie das Gefühl, als Frau weniger ernst genommen zu werden. Natürlich kann das in anderen Ländern oder Branchen anders sein!
Was aber auffällt: In Gesprächen mit Investorinnen und Investoren taucht immer wieder eine bestimmte Frage auf, meist subtil formuliert, aber doch präsent: «Planst du, Kinder zu bekommen?» Das zeigt, dass bestimmte Denkmuster immer noch da sind, die wir weiter aktiv durchbrechen müssen. Trotzdem spüre ich insgesamt Rückenwind.
Was ist das grösste Missverständnis über Kreislaufwirtschaft oder Recycling, das dich stört?
Viele Menschen denken, dass Recycling bedeutet: Ich werfe etwas in den richtigen Behälter und dann wird schon alles gut. Aber so einfach ist es nicht. Besonders beim Kunststoffrecycling wird oft unterschätzt, wie komplex die Prozesse sind und wie wichtig es ist, Materialien sauber zu trennen und vorzubereiten.
Ein Beispiel: In Kanada gab es Sammelsysteme, bei denen alles – Plastik, Glas, Metall – in einer einzigen Tonne landete. Die Idee war, das später zu sortieren. Aber in der Realität wurde vieles davon einfach exportiert oder verbrannt. In der Schweiz ist das deutlich besser gelöst, mit einem grösseren Bewusstsein für saubere Trennung.
Was mich aber fast noch mehr irritiert, ist, dass viele nicht wissen, wo überall Kunststoff drinsteckt: Die PET-Wasserflasche ist aus dem gleichen Material wie ein Polyester-Shirt, nur sehen wir das oft nicht. Kleidung, Verpackung, Baustoffe, überall steckt Plastik drin. Und wir sprechen als Gesellschaft viel zu wenig darüber.
Was habt ihr bei DePoly technologisch anders gemacht als andere Recycling-Lösungen?
Andere Anbieter arbeiten ebenfalls an PET-Recyclinglösungen, aber eben mit anderen Methoden. Unser Verfahren funktioniert bei Raumtemperatur und Normaldruck, also ohne Hitze oder hohen Energieeinsatz. Das spart Ressourcen und macht es einfacher, das Verfahren in grossem Massstab umzusetzen. Und wir arbeiten mit einfachen, nachhaltigen Chemikalien – viele davon sind handelsüblich oder sogar aus Reststoffen gewonnen, wie Schwefelverbindungen aus Wein.
Würdest du heute nochmals ein Recycling-Startup gründen oder waren die Herausforderungen zu gross?
Ja, ich würde definitiv wieder eines gründen. Natürlich war und ist es herausfordernd – aber jetzt weiss ich viel mehr. Ich habe ursprünglich davon geträumt, in die Industrie zu gehen und etwas zu verändern. Recycling war nicht von Anfang an mein Ziel, aber es wurde schnell zu der spannendsten Möglichkeit, meine Kenntnisse aus der Chemie sinnvoll einzusetzen.
Man lernt unglaublich viel auf diesem Weg: über Technologie, Unternehmertum, Teamführung, aber auch über sich selbst. Ich glaube fest daran, dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unsere Verantwortung auch darin sehen sollten, Lösungen aus dem Labor in die Welt zu bringen. Und genau das versuchen wir bei DePoly.
Was sind eure nächsten Meilensteine und wie sieht eure ideale Zukunft in zehn Jahren aus?
In den nächsten zwei bis drei Jahren wollen wir unsere Technologie aus dem Pilotmassstab in die grosstechnische Umsetzung bringen. Mit einem Showcase-Werk in Monthey legen wir gerade den Grundstein für unsere erste kommerzielle Anlage und planen bereits die nächste. Unser Ziel ist es, jährlich zehntausende Tonnen Kunststoffabfall zu verarbeiten, nicht nur PET, sondern auch Textilien, Verpackungen und perspektivisch sogar Kunststoffe aus der Bau- oder Automobilindustrie. Dabei denken wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vom Abfallstrom bis zum neuen Rohstoff.
Langfristig stellen wir uns vor, auf jedem Kontinent mindestens eine Anlage zu betreiben und eine Welt zu schaffen, in der kein Plastik mehr in der Umwelt landet. Dafür entwickeln wir unsere Technologie kontinuierlich weiter, um künftig auch Polyolefine, PVC und andere schwer recycelbare Kunststoffe zu erfassen. Unser Ziel ist also ein globales, skalierbares System, das Plastik nicht länger als Abfall, sondern als Ressource begreift.
Dir hat der Artikel gefallen?
Dann wirf doch auch einen Blick auf unseren letzten Beitrag – viel Spass beim lesen!
FOUNDED
Videoformat
“23 Questions mit…”
In unserem neuen Format stellen wir Gründerinnen, Gründern oder Teammitgliedern 23 Fragen in einem One-Take – während wir durch die Firma gehen. Kein Skript, kein Cut, kein Studio. Nur echtes Startup-Leben.
23 Questions mit Scewo.
Samantha Anderson war Chemikerin, als sie sich entschied, nicht nur zu forschen, sondern eine Lösung zu bauen. Mit DePoly zerlegt sie nicht nur PET-Flaschen, sondern auch gängige Vorstellungen von Recycling.
Wie würdest du DePoly einem zwölfjährigen Kind erklären, das gerade zum ersten Mal von Recycling und zirkulärer Wirtschaft hört?
Stell dir vor, du machst für deine beste Freundin ein Armband, das aus bunten Perlen besteht. Wenn du dich später umentscheiden und aus genau diesen Perlen eine Kette basteln willst, musst du das Armband wieder auseinandernehmen, oder? Genau das macht DePoly mit Plastik. Unsere Technologie nimmt altes Plastik, das sonst verbrannt oder weggeworfen würde, und zerlegt es wieder in seine Einzelteile, um dann später wieder ein neues Produkt aus den Einzelteilen entstehen zu lassen – ganz wie bei dem Armband.
Wir glauben daran, dass Recycling nicht kompliziert sein muss, sondern nur die richtige Handhabe braucht. Unsere Technologie zerlegt Plastik nicht nur, sie funktioniert auch mit Plastik, das normalerweise gar nicht recycelbar wäre, wie bunt gemischter Verpackungsmüll oder alte Textilien. Wir geben Kunststoffabfällen also ein zweites Leben und helfen damit, die Umwelt zu entlasten.
Wann wurde euch klar, dass aus eurem Forschungsprojekt ein Unternehmen werden sollte?
2018 war plötzlich überall von Mikroplastik die Rede, in den Medien, in der Politik, in der Forschung. Immer mehr Studien zeigten, dass sich Mikroplastik in unserem Körper nachweisen lässt. Doch aus wissenschaftlicher Sicht gab es damals noch keine Antworten auf die Frage: Was macht dieses Plastik eigentlich mit uns? Das war natürlich fatal und hat mich entsprechend angetrieben, eine Lösung für dieses riesige Problem zu finden.
Gemeinsam mit meinen Mitgründern Christopher und Bardiya habe ich dann beschlossen, genau dort anzusetzen, und zwar mit Hilfe meines Backgrounds als Chemikerin. Mit einem chemischen Ansatz wollten wir Plastik in seine Einzelteile zurückführen. Das Forschungsprojekt sollte von Anfang an nicht akademisch bleiben. Wir wollten eine skalierbare Technologie schaffen, und das ging am schnellsten mit einem Startup.
Wie verändert sich die Rolle als CEO, wenn aus Laborlogik plötzlich industrielle Skalierung wird?
Am Anfang hat sich meine Rolle als CEO gar nicht so sehr von der wissenschaftlichen Arbeit unterschieden, sodass es sich noch sehr vertraut angefühlt hat. Wir waren ein kleines Team, weniger als zehn Personen, und haben gemeinsam überlegt, wie wir unsere Technologie weiterentwickeln und in Richtung Kommerzialisierung bringen können. Ich war noch sehr nah an der Forschung dran.
Irgendwann kommt dann der Punkt, an dem man beginnt, Aufgaben abzugeben. Es gibt diesen Artikel von Molly Graham mit dem Titel «Give Away Your Legos», der beschreibt, wie man in einem Startup lernen muss, bestimmte Verantwortlichkeiten loszulassen, um Platz für neue Rollen und Wachstum zu schaffen. Und genau das passiert. Man stellt Leute ein, die Dinge besser können als man selbst, und plötzlich ist man nicht mehr im Labor, sondern hält Präsentationen vor Investorinnen und Investoren, schreibt Businesspläne und beschäftigt sich mit Teamführung, Unternehmensaufbau und Finanzierung.
Heute habe ich mit der eigentlichen Chemie kaum noch etwas zu tun. Natürlich vermisse ich manchmal die wissenschaftliche Arbeit, ich war zehn Jahre lang Chemikerin und liebe die Neugier, das Entdecken. Aber auf der anderen Seite sehe ich jetzt dieses Unternehmen entstehen und wachsen. Es ist ein bisschen so, als würde man ein Kind beim Aufwachsen beobachten, das nimmt mir die Wehmut nach dem Labor.
Wie findet man die richtigen Leute, um ein Forschungsteam zu ergänzen und gleichzeitig ein Start-up aufzubauen?
Wenn es um das wissenschaftliche Team ging, war das anfangs noch relativ einfach, da habe ich mich in einer vertrauten Welt bewegt. Man kennt viele Leute aus der Forschung, weiss, wie sie arbeiten, und kann gut einschätzen, wer ins Team passt. Schwieriger wird es bei den Businessrollen: Wer sich aus der Forschung heraus selbstständig macht, bringt selten Erfahrung im Aufbau eines Unternehmens mit. Uns hat da vor allem unser Netzwerk geholfen, insbesondere unser VC Founderful. Sie haben uns mit Leuten aus ihrem Ökosystem verbunden, das war super hilfreich.
Und wie bringt ihr eure Technologie dann aus dem Labor in die Industrie?
Wir arbeiten eng mit Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen, von der chemischen Industrie über Abfüller bis hin zu Textilherstellern. Besonders stolz sind wir auf das jüngste Projekt mit der Sportmarke Odlo: Gemeinsam entwickeln wir den ersten vollständig zirkulären Base Layer der Marke. Dabei wird gebrauchte Funktionskleidung mit unserer Technologie wieder in hochwertige Rohstoffe zerlegt und daraus ein neues Kleidungsstück geschaffen. Dieses Pilotprojekt ist ein wichtiger Beweis dafür, wie echte Kreislaufwirtschaft in der Realität funktionieren kann. Solche Kooperationen zeigen, dass Recycling nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein industriell relevantes Modell ist.
Ihr arbeitet an einer bekannten Herausforderung. Wie politisch darf oder sollte man als Gründerin sein?
Als Gründerin sehe ich es als selbstverständlich an, für unsere Technologie und unser Anliegen einzustehen, gerade weil wir an einem der grossen systemischen Probleme unserer Zeit arbeiten: unsere Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen und die daraus resultierende Plastikverschmutzung. Ich bin daher offen für Gespräche mit Verbänden oder politischen Entscheidungstragenden, um unser Wissen einzubringen und auf die strukturellen Herausforderungen hinzuweisen. Generell bin ich aber kein besonders politisch aktiver Mensch, zumindest nicht auf Social Media. Unsere Herangehensweise ist eher edukativ.
Wir investieren Zeit in Aufklärungsarbeit, sprechen in Schulen, empfangen Kinder in unseren Laboren und erklären ihnen, wie unsere Technologie funktioniert. Denn echte Veränderung beginnt oft mit Verständnis.
Wie erlebst du das Gründen als Frau, gerade in der Tech-Welt?
Ich persönlich habe bisher positive Erfahrungen gemacht. Die Schweizer Gründungscommunity ist respektvoll, offen und unterstützt Frauen, zumindest so, wie ich es erlebt habe. Ich fühle mich in diesem Umfeld sehr wohl und hatte nie das Gefühl, als Frau weniger ernst genommen zu werden. Natürlich kann das in anderen Ländern oder Branchen anders sein!
Was aber auffällt: In Gesprächen mit Investorinnen und Investoren taucht immer wieder eine bestimmte Frage auf, meist subtil formuliert, aber doch präsent: «Planst du, Kinder zu bekommen?» Das zeigt, dass bestimmte Denkmuster immer noch da sind, die wir weiter aktiv durchbrechen müssen. Trotzdem spüre ich insgesamt Rückenwind.
Was ist das grösste Missverständnis über Kreislaufwirtschaft oder Recycling, das dich stört?
Viele Menschen denken, dass Recycling bedeutet: Ich werfe etwas in den richtigen Behälter und dann wird schon alles gut. Aber so einfach ist es nicht. Besonders beim Kunststoffrecycling wird oft unterschätzt, wie komplex die Prozesse sind und wie wichtig es ist, Materialien sauber zu trennen und vorzubereiten.
Ein Beispiel: In Kanada gab es Sammelsysteme, bei denen alles – Plastik, Glas, Metall – in einer einzigen Tonne landete. Die Idee war, das später zu sortieren. Aber in der Realität wurde vieles davon einfach exportiert oder verbrannt. In der Schweiz ist das deutlich besser gelöst, mit einem grösseren Bewusstsein für saubere Trennung.
Was mich aber fast noch mehr irritiert, ist, dass viele nicht wissen, wo überall Kunststoff drinsteckt: Die PET-Wasserflasche ist aus dem gleichen Material wie ein Polyester-Shirt, nur sehen wir das oft nicht. Kleidung, Verpackung, Baustoffe, überall steckt Plastik drin. Und wir sprechen als Gesellschaft viel zu wenig darüber.
Was habt ihr bei DePoly technologisch anders gemacht als andere Recycling-Lösungen?
Andere Anbieter arbeiten ebenfalls an PET-Recyclinglösungen, aber eben mit anderen Methoden. Unser Verfahren funktioniert bei Raumtemperatur und Normaldruck, also ohne Hitze oder hohen Energieeinsatz. Das spart Ressourcen und macht es einfacher, das Verfahren in grossem Massstab umzusetzen. Und wir arbeiten mit einfachen, nachhaltigen Chemikalien – viele davon sind handelsüblich oder sogar aus Reststoffen gewonnen, wie Schwefelverbindungen aus Wein.
Würdest du heute nochmals ein Recycling-Startup gründen oder waren die Herausforderungen zu gross?
Ja, ich würde definitiv wieder eines gründen. Natürlich war und ist es herausfordernd – aber jetzt weiss ich viel mehr. Ich habe ursprünglich davon geträumt, in die Industrie zu gehen und etwas zu verändern. Recycling war nicht von Anfang an mein Ziel, aber es wurde schnell zu der spannendsten Möglichkeit, meine Kenntnisse aus der Chemie sinnvoll einzusetzen.
Man lernt unglaublich viel auf diesem Weg: über Technologie, Unternehmertum, Teamführung, aber auch über sich selbst. Ich glaube fest daran, dass wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unsere Verantwortung auch darin sehen sollten, Lösungen aus dem Labor in die Welt zu bringen. Und genau das versuchen wir bei DePoly.
Was sind eure nächsten Meilensteine und wie sieht eure ideale Zukunft in zehn Jahren aus?
In den nächsten zwei bis drei Jahren wollen wir unsere Technologie aus dem Pilotmassstab in die grosstechnische Umsetzung bringen. Mit einem Showcase-Werk in Monthey legen wir gerade den Grundstein für unsere erste kommerzielle Anlage und planen bereits die nächste. Unser Ziel ist es, jährlich zehntausende Tonnen Kunststoffabfall zu verarbeiten, nicht nur PET, sondern auch Textilien, Verpackungen und perspektivisch sogar Kunststoffe aus der Bau- oder Automobilindustrie. Dabei denken wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vom Abfallstrom bis zum neuen Rohstoff.
Langfristig stellen wir uns vor, auf jedem Kontinent mindestens eine Anlage zu betreiben und eine Welt zu schaffen, in der kein Plastik mehr in der Umwelt landet. Dafür entwickeln wir unsere Technologie kontinuierlich weiter, um künftig auch Polyolefine, PVC und andere schwer recycelbare Kunststoffe zu erfassen. Unser Ziel ist also ein globales, skalierbares System, das Plastik nicht länger als Abfall, sondern als Ressource begreift.
Dir hat der Artikel gefallen?
Dann wirf doch auch einen Blick auf unseren letzten Beitrag – viel Spass beim lesen!